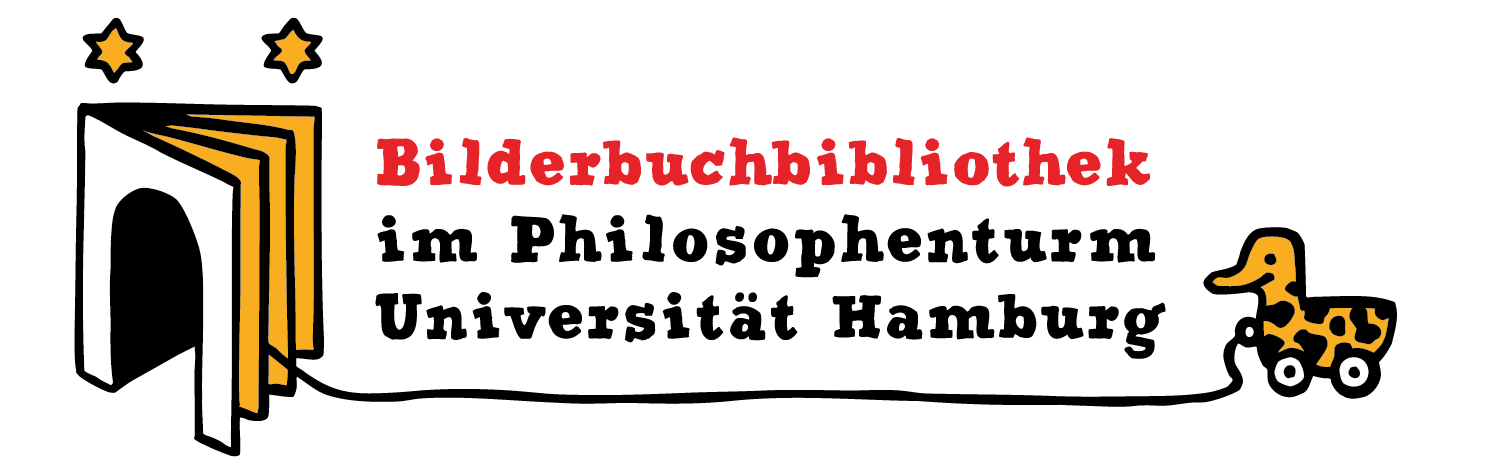Tagung "Leben wie im Film"
Universität Hamburg/Wuppertal/Kinder- und Jugendfilmzentrum
Vom 22. bis 25. Oktober 2025 findet auf dem Campus der Universität Hamburg und im Kino Abaton die Tagung "Leben wie im Film". (Aktuelle) Entwicklungen des Kinder- und Jugendfilms statt.  Audiovisuelle Erzählungen über Kindheit und Jugend und für Kinder und Jugendliche boomen: Teen-Serien sind im Angebot der Streamingdienste omnipräsent, Kinderfilme laufen publikumswirksam in den Kinos, Coming-of-Age-Filme konkurrieren um die großen Filmpreise. Auch die deutschsprachige Forschung hat sich in den letzten Jahren mit Aspekten des Kinder- und Jugendfilms und von Kinder- und Jugendserien beschäftigt. Doch bei einem Blick auf die vielfältigen Themen, Motive, Tendenzen und Wirkungen des Kinder- und Jugendfilms – damit sind im Folgenden auch immer Kinder- und Jugendserien gemeint – besteht insgesamt ein Forschungsdesiderat. Das gilt für die Kinder- und Jugendmedienforschung, die tendenziell vor allem literarische, auditive und visuelle Formate untersucht, aber auch für die deutschsprachige Film- und Medienwissenschaft, die Kinder- und Jugendfilme wenig berücksichtigt – im Unterschied etwa zur insgesamt breiter ausgerichteten angloamerikanischen Forschung.
Audiovisuelle Erzählungen über Kindheit und Jugend und für Kinder und Jugendliche boomen: Teen-Serien sind im Angebot der Streamingdienste omnipräsent, Kinderfilme laufen publikumswirksam in den Kinos, Coming-of-Age-Filme konkurrieren um die großen Filmpreise. Auch die deutschsprachige Forschung hat sich in den letzten Jahren mit Aspekten des Kinder- und Jugendfilms und von Kinder- und Jugendserien beschäftigt. Doch bei einem Blick auf die vielfältigen Themen, Motive, Tendenzen und Wirkungen des Kinder- und Jugendfilms – damit sind im Folgenden auch immer Kinder- und Jugendserien gemeint – besteht insgesamt ein Forschungsdesiderat. Das gilt für die Kinder- und Jugendmedienforschung, die tendenziell vor allem literarische, auditive und visuelle Formate untersucht, aber auch für die deutschsprachige Film- und Medienwissenschaft, die Kinder- und Jugendfilme wenig berücksichtigt – im Unterschied etwa zur insgesamt breiter ausgerichteten angloamerikanischen Forschung.
Ausgehend von der Bedeutung des Kinder- und Jugendfilms für die aktuelle Film- und Serienlandschaft möchte die Tagung einen breit angelegten Rahmen für Diskussionen eröffnen und einen Beitrag leisten, um einen systematischen Diskurs über Kinder- und Jugendfilme zu initiieren. Der Fokus soll dabei auf aktuellen Kinderfilmen und Jugendfilmen liegen, die Filmgeschichte als Rahmung aber mitgedacht werden – z.B. in Form von Abgrenzungen oder Weiterentwicklungen, Motiven und ihren konstellativen Inszenierungen, (intertextuellen und transkulturellen) Bezügen, musikalischen bzw. auralen Strukturen. Kinderfilme und Jugendfilme zeichnen sich u.a. durch unterschiedliche Erzähl- und Darstellungsformen aus, daher wird eine Differenzierung vorgenommen, die sich auch in der Tagungsstruktur äußern wird.
Organisation: Christian Exner (Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum), Prof. Dr. Tobias Kurwinkel (Universität Hamburg), Dr. Frank Münschke (Bergische Universität Wuppertal), Carina Schlichting (Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum), Dr. Philipp Schmerheim (Universität Hamburg)
| Zur Internetseite der Tagung |